Ein systemischer Blick auf Inspiration, Überforderung und das Bedürfnis nach innerer Ordnung
Während ich beim Joggen einen Podcast anhöre, genieße ich die zuverlässig beim Laufen einsetzende fließende Gedankenklarheit (Dopamin ist was Feines). Gleichzeitig spüre ich, wie durch den Input lauter neue Ideen aufblinken und sehe mein Hirn bildlich als geschüttelte Schneekugel mit leuchtenden Ideen-Schneeflocken vor mir: wem ich die Folge weiterleiten möchte, was ich dazu noch nachlesen mag, wo ich das erwähnte Workbook in meiner Praxis einsetzen werde. Während sich das einerseits gut anfühlt, merke ich auch, dass es Druck erzeugt und in mir ein Bedürfnis nach Abschottung auslöst. Ich ahne, dass mich, gehe ich allen Impulsen nach, schnell Überforderung ereilen wird und möchte mich pro-aktiv davor schützen. Dieses Dilemma, oder positiver formuliert, dieser herausfordernde Balanceakt, begleitet mich auch bei Begegnungen, Gesprächen, beim Lesen und beim Scrollen im Internet.
Im therapeutischen Kontext sprechen wir oft von Resonanz, wenn wir die feinen, manchmal schwer greifbaren Wirkungen meinen, die Begegnungen hinterlassen. Resonanz ist kein lauter Impuls, sondern ein inneres Mitschwingen. Sie kann bereichern, klären, irritieren, überfordern oder alles zugleich.
Auch außerhalb des Beratungsraums begegnet mir diese Form der Berührung immer wieder: Ein Satz in einem Podcast. Ein Bild in einem sozialen Medium. Ein Gespräch, das unerwartet in die Tiefe geht. Ein wissenschaftlicher Artikel, der mich auf eine neue Idee bringt. Es sind Momente, in denen etwas in mir intellektuell, emotional, manchmal körperlich spürbar in Bewegung gerät.
Und genau darin liegt eine Ambivalenz, die viele Menschen kennen, insbesondere jene mit einer hohen kognitiven Sensibilität oder neurodivergenten Wahrnehmung: Das Berührtwerden durch Inhalte und Begegnungen ist zutiefst anregend und zugleich potenziell überfordernd.
Ich erlebe häufig, wie mein inneres System nach solchen Berührungen in einen Zustand gesteigerter Aktivität kippt. Gedanken ordnen sich neu, Assoziationen entstehen, Ideen für neue Projekte, Texte oder Formate drängen an die Oberfläche. Es fühlt sich an wie eine kognitive Explosion: vielfältig, lebendig und kaum kanalisiert.
Systemisch betrachtet sind solche Prozesse keine Störung, sondern Ausdruck eines aktiven, verbundenen inneren Systems. Es ist ein Zeichen von Lebendigkeit, wenn innere Bewegung auf äußere Impulse folgt. Doch Lebendigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Produktivität. Und genau hier beginnt oft die Schwierigkeit.
Denn aus jeder Inspiration entsteht – zumindest potenziell – eine Erwartung: Daraus könnte ich etwas machen. Sollte ich vielleicht sogar.
In systemischer Sprache: Die Impulse aktivieren innere Aufträge. Sie reaktivieren Anteile, die leisten, ordnen, sichtbar machen wollen. Gleichzeitig geraten andere Anteile, die nach Ruhe, Integration, abschließendem Erledigen streben, unter Druck. Die Folge ist ein innerer Zielkonflikt, den viele Menschen nicht bewusst wahrnehmen, wohl aber in Form von Überforderung oder Selbstkritik erleben.
Ich beobachte bei mir und bei vielen meiner Klient:innen, dass der Umgang mit solchen Resonanzphänomenen weniger eine Frage von Disziplin ist, sondern eine Frage von Haltung.
Wie gehe ich damit um, dass ich durchlässig bin?
Wie gestalte ich meine eigenen Filter?
Wie finde ich eine Dosis, die nicht ins Vermeiden kippt, aber auch nicht ins Überflutetwerden?
Systemische Beratung kennt keine Rezepte, aber sie kennt die Kraft der Selbstbeobachtung. In meinem Fall bedeutet das: Ich nehme mir bewusst Räume, in Form von Zeitblöcken im Kalender an einem Ort möglichst ohne Ablenkung, zum Sortieren. Nicht, um noch produktiver zu werden, sondern um Verbindungen zu erkennen, Dinge abzuschließen, Fragmente zusammenzuführen. Ich schreibe, nicht um zu liefern, sondern um mich und die Welt zu verstehen. Ich frage mich nicht, was ich noch aufnehmen sollte, sondern: Was davon gehört wirklich zu mir?
Denn nicht alles, was mich berührt, gehört auch in mein Leben. Manche Impulse dürfen einfach vorbeiziehen. Nicht alles muss weiterverarbeitet, umgesetzt oder veröffentlicht werden. Es ist kein Scheitern, einen Gedanken nicht weiterzuverfolgen. Es ist ein Akt der Selbstfürsorge. Oft hilft es mir, erst alles aufzuschreiben und dann am nächsten Tag oder nach einer Woche zu prüfen, was davon immer noch „zu mir spricht“.
Vielleicht ist das die eigentliche Kompetenz, die wir im Zeitalter ständiger Verfügbarkeit brauchen:
Zwischen Reiz und Reaktion innezuhalten.
Zwischen Impuls und Output einen Raum zu schaffen.
Zwischen „Das ist spannend“ und „Das ist meins“ unterscheiden zu können.
Und vielleicht beginnt dieser Raum mit der einfachen Frage:
Was und wer berührt mich und was will ich damit tun?
Schön, dass du da bist.
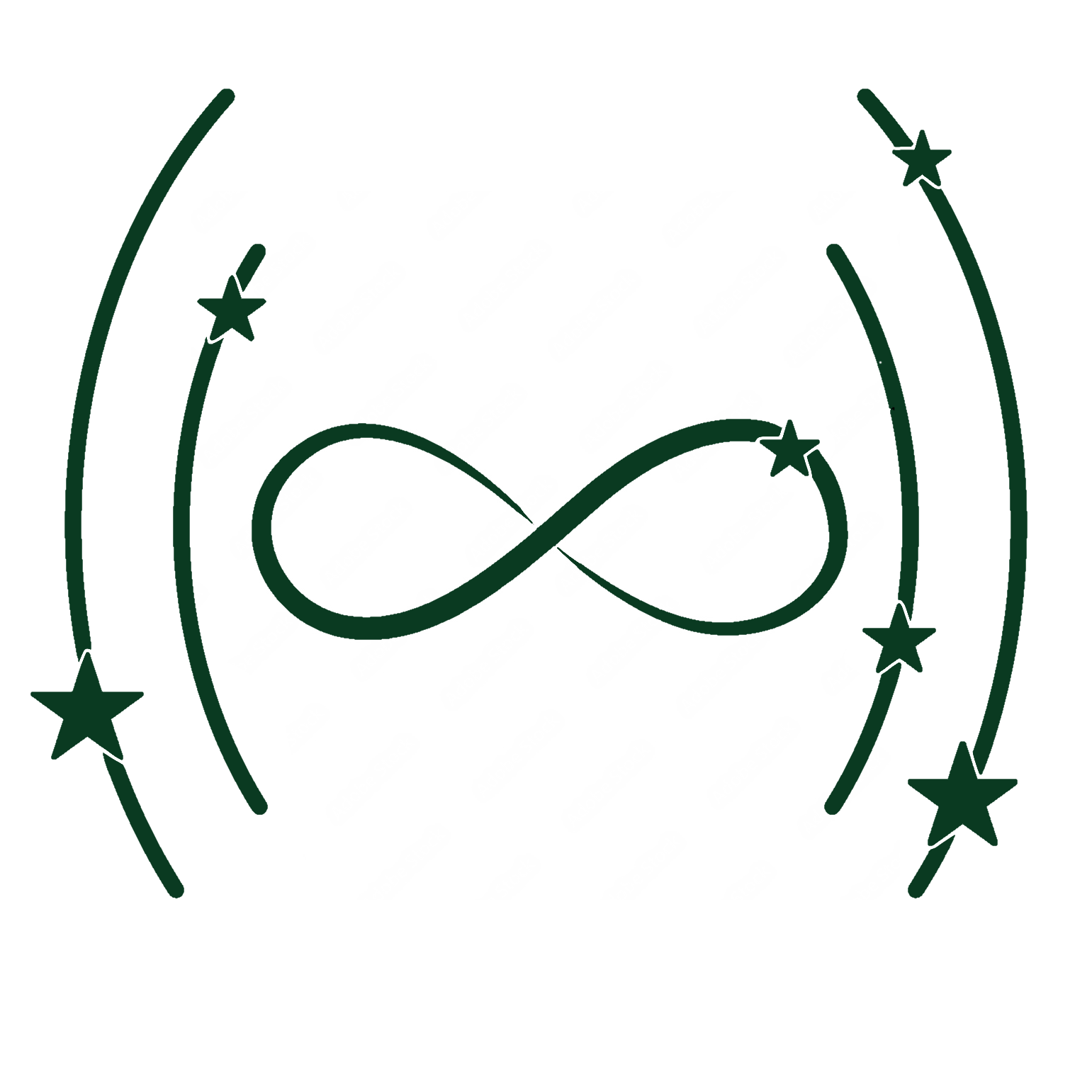

Schreibe einen Kommentar